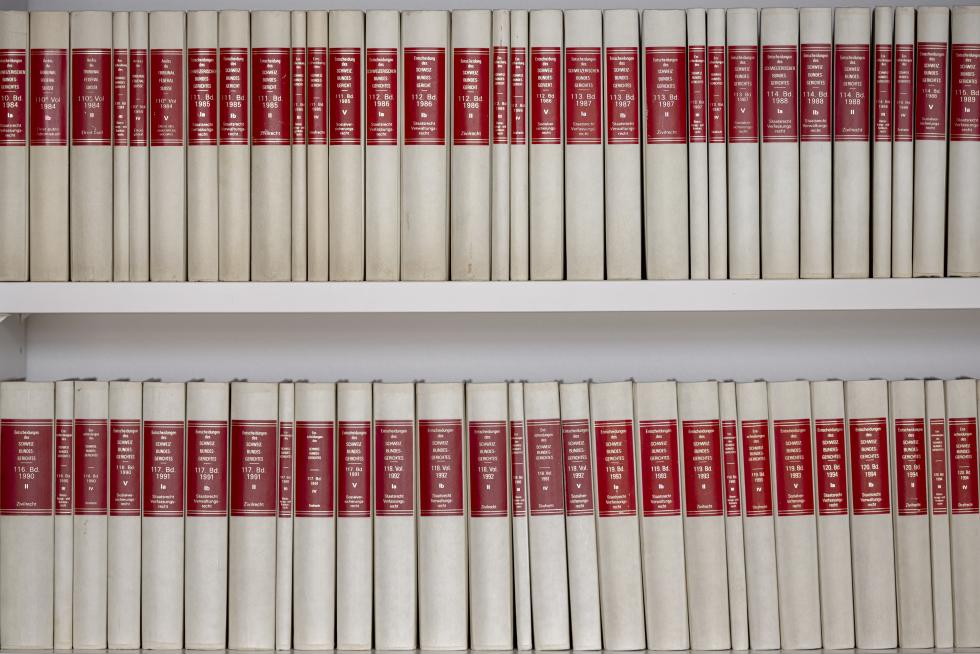Arbeitsrecht
Konkurrenzverbote im Arbeitsverhältnis: Von der Theorie zur Praxis
Das nachvertragliche Konkurrenzverbot ist ein Thema, mit dem wir in unserer anwaltlichen Praxis oft konfrontiert werden. Schon die richtige Formulierung im Arbeitsvertrag stellt eine Herausforderung dar: Welche Klauseln sind rechtlich gültig? Wie setzt man das Verbot im Ernstfall durch? Lohnt sich der Aufwand überhaupt?
Arbeitgeberinnen haben ein berechtigtes Interesse, das firmeninterne Know-How und den Kundenstamm zu schützen und sehen daher in ihren Arbeitsverträgen regelmässig Konkurrenzverbote vor. Ob und inwiefern diese aber tatsächlich gültig und durchsetzbar sind, ist häufig strittig.
1. Prävention: Aufgepasst bei der Formulierung und den Formvorschriften
Das Gesetz verlangt zwingend, dass das Konkurrenzverbot «schriftlich» abgeschlossen wird. Dies bedeutet, dass das Konkurrenzverbot in einem schriftlichen Arbeitsvertrag enthalten sein muss, der handschriftlich oder mittels qualifizierter elektronischer Signatur unterzeichnet wurde. Wird die Unterschrift mittels nicht-qualifizierten Signaturdiensten wie beispielsweise Dokusign oder Skribble gesetzt oder wird mit einer eingescannten Unterschrift gearbeitet, so ist diese Voraussetzung nicht erfüllt und ein Konkurrenzverbot ist gänzlich hinfällig.
Im Übrigen wird verlangt, dass das Konkurrenzverbot nicht übermässig ist in Bezug auf die sachliche und territoriale Ausdehnung sowie Geltungsdauer. Den Gerichten kommt hier ein grosser Ermessensspielraum zu und Konkurrenzverbote werden regelmässig im Nachhinein reduziert, eingeschränkt oder entfallen ganz. Je nach Situation kann es zudem vorteilhaft sein, wenn zusätzlich zum oder gar anstelle des Konkurrenzverbots ein Abwerbeverbot oder eine Kundenschutzklausel vereinbart wird.
Für eine erleichterte Durchsetzbarkeit und somit effektiven Schutz in der Zukunft lohnt sich der genaue Blick bereits am Anfang: Ein unmissverständlich formuliertes, realistisches und situationsbezogenes Konkurrenzverbot, welches mit den notwendigen Durchsetzungsmeachnismen verknüpft wird.
2. Durchsetzung: Im Ernstfall richtig reagieren und schnell handeln
Doch selbst wenn die Formalitäten stimmen, bedeutet das nicht automatisch die garantierte Durchsetzbarkeit. Insbesondere verlangt das Gesetz, dass der oder die Mitarbeitende überhaupt Zugang zu sensiblen Kundendaten oder Geschäftsgeheimnissen hatte und deren Nutzung der ehemaligen Arbeitgeberin tatsächlich schaden könnte.
Besonders schwierig wird es bei Berufen, in denen die persönliche Beziehung zwischen Kunden und Mitarbeitenden im Mittelpunkt steht. Beispielsweise wechseln Mandanten von Anwältinnen oder Architektinnen sowie Patienten von Ärzten oft nicht wegen der (grundsätzlich in Konkurrenz stehenden) Kanzlei oder Praxis mit der beratenden oder behandelnden Person mit, sondern wegen des besonderen Vertrauensverhältnisses zu dieser. In solchen Fällen ist ein Konkurrenzverbot häufig nicht durchsetzbar.
Erleichtert wird die Durchsetzung in jedem Fall, wenn eine Konventionalstrafe von Anfang an vertraglich vorgesehen wird. Diese kann dann direkt vom vertragsbrüchigen Mitarbeitenden eingefordert werden, notfalls auf dem Betreibungsweg. Ausserdem sollte man an die Realvollstreckung denken, damit effektiv von einer ehemaligen Mitarbeiterin verlangt werden kann, dass die konkurrenzierende Tätigkeit sofort niedergelegt wird. Hier muss im Ernstfall schnell und präzis gehandelt werden, damit ohne Verzug eine entsprechende superprovisorische Massnahme gerichtlich verfügt werden kann. Wartet man zu lange, so kommt diese Massnahme regelmässig nicht durch oder es lohnt sich zeitlich nicht mehr, weil das Konkurrenzverbot demnächst ausläuft.
3. Konkurrenzverbot im öffentlichen Dienst: Eine andere Welt
Doch wie sieht es in der öffentlichen Verwaltung aus? Als staatliche Arbeitgeberin ist die Verwaltung an die verfassungsmässig garantierten Grundrechte gebunden, insbesondere an die Wirtschaftsfreiheit. Ein nachvertragliches Konkurrenzverbot muss daher auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen, im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
Konkurrenzverbote im öffentlichen Personalrecht scheitern in den meisten Kantonen bereits am Fehlen einer gesetzlichen Grundlage. Dies zeigt auch das folgende Beispiel aus dem Kanton Zürich: Ein Arzt, der vom Universitätsspital Zürich zu einem Privatspital wechselte, sollte durch ein solches Verbot eingeschränkt werden. Doch das Verwaltungsgericht stellte klar: Ohne gesetzliche Grundlage ist ein derartiger Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit nicht zulässig und das Konkurrenzverbot wurde für ungültig erklärt (Entscheid VB.2016.00044 vom 29.6.2016).